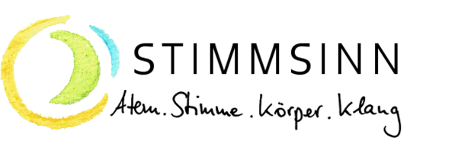Anknüpfend an meinen Artikel von letzter Woche, möchte ich nochmal auf meinen „Ohren auf!“ Workshop zurückkommen. Wenn wir kommunizieren – und das tun wir selbstverständlich, wenn wir singen – treten wir immer auf unterschiedlichen Ebenen in Kontakt. Hier möchte ich das – vor langer Zeit von meiner ehemaligen Lehrerin Alexandra Naumann in einer Projektwoche im Rahmen meines Studiums vorgestellte – Modell „Mit vier Ohren singen“ beschreiben. Ursprünglich wurde diese Idee unter dem Titel „Das Kommunikationsquadrat“ vom Kommunikationsforscher FRIEDEMANN SCHULZ VON THUN entwickelt und ausgearbeitet. Das Modell eignet sich hervorragend, um verschiedene Aspekte des Singens – allein unter der Dusche, in einer Gruppe, auf der Bühne oder in einem Chor – aber auch in der gesangspädagogischen Arbeit zu konkretisieren und miteinander in Beziehung zu setzen.
Die Ampel ist rot
Wir stellen uns ein Ehepaar
vor, welches in einem Auto fährt. Nehmen wir an, die Frau sitzt am
Steuer und ihr Partner sitzt auf dem Beifahrersitz. Er sagt:“ Die Ampel
ist rot!“ Was können wir allein aus diesem kleinen Sätzchen über die
Situation erfahren? Zum Einen geht es um den puren Sachinhalt der
Aussage. Die Ampel ist rot. Die obere, rot gefärbte Lampe der
Ampelanlage leuchtet.
Doch nach SCHULZ VON THUN gibt es drei weitere Kommunikatonsebenen.
Zunächst den Appell. „Die Ampel ist rot. Halte an!“ ein Aufruf, eine
Aufforderung geht vom Sender an den Empfänger. Unser Beifahrer kann den
Satz aber auch auf der Beziehungsebene meinen. Vielleicht als Versuch
der Kontaktaufnahme nach einer Redepause, aus liebevoller Zuwendung,
aber auch als Beschimpfung oder aus Machtgehabe. „Hast Du keine Augen im
Kopf?“ „Wir sind doch schon spät dran!“ „Weil Du das Auto abgewürgt
hast, stehen wir immer noch hier.“ Aber auch: „Ich kann das von meinem
Standpunkt aus besser sehen als Du, also helfe ich Dir.“ Durch die
jeweilige Betonung, den Stimmklang, die Sprachmelodie und die enthaltene
emotionale Information, kann der gleiche Satz ganz unterschiedliche
Informationen auf der Beziehungsebene übertragen.
Ebenso erzählt die
Art und Weise, wie er diesen Satz sagt, natürlich auch über ihn selbst.
„Ich bin genervt.“, „Ich habe Angst.“, „Ich fühle mich gehetzt.“ oder
„Ich bin müde.“. SCHULZ VON THUN nennt diese Ebene den
Selbstoffenbahrungsaspekt.
Störung der Kommunikation
In jeder Kommunikation
werden sowohl vom Sender, als auch vom Empfänger Informationen auf allen
diesen vier Ebenen ausgesandt, beziehungweise gehört.
Kommunikationsprobleme treten immer dann auf, wenn der Sender auf der
einen Ebene spricht und der Empfänger auf einem anderen Ohr hört oder
aber einer der Kommunikationspartner eine der Ebenen nicht wahrnimmt und
somit Information unterwegs verloren geht. Wenn unser Beifahrer
eigentlich ausdrücken möchte „Ich bin müde.“, seine Partnerin aber auf
dem Beziehungsohr hört, wird sie sich vielleicht ganz ohne Grund
angegriffen fühlen.
Wie kann dieses Modell nun auf das Singen übertragen werden? Welche Apekte des Singens werden auf welchem Ohr gehört, wie kann der Sender seine Klarheit auf der einen oder anderen Ebene verstärken?
Der Sänger hat vier Ohren
Als Sachinhalt beim
Singen, betrachte ich die äußere Form dessen, was gesungen wird. Welche
Tonhöhe wird auf welchem Vokal gesungen, welche Silbe, welches Wort
findet wann statt? Ist der Ton laut oder leise, lang oder kurz? Sauber
intoniert oder leicht schräg? In welchem rhythmischen Ablauf finden die
Töne statt? Welche Akkorde ergeben sich, wenn mehrere Stimmen zusammen
singen? Welche Formteile hat das Lied? Usw.
Sehr häufig beschäftigen
wir uns intensiv mit dieser Ebene. Wir möchten richtig und schön singen,
rhythmisch klar sein und die zweite Strophe mit dem richtigen Text nach
der ersten singen. Doch Singen ist so viel mehr als das.
Singen ist Appell. Der Chor möchte die Menschen zum Lachen oder Weinen einladen, der Sänger einer Partyband, möchte dass die Menschen mitklatschen oder tanzen. Die klassische Liedsängerin möchte innere Bilder in den Menschen hervorrufen, das Orchester möchte nach dem kraftvollen Schlussakkord mit Applaus belohnt werden.
Gleichwohl ist Singen immer auch Selbstoffenbahrung. Wir Sänger möchten uns ausdrücken, uns öffnen. Mal als der, der wir wirklich sind, mal in einer Rolle. Manchmal möchten wir uns auch nicht zeigen und auch das offenbahrt viel von uns selbst. „Ich bin aufgeregt. Ich habe Lampenfieber. Das Singen macht mir Freude. Ich leide mit der Figur. Das Lied berührt mich. Ich überspiele meine Unsicherheit mit Lautheit oder unverfänglichen Klischees.“ Das sind nur einige wenige von vielen Aussagen, die der Zuhörer auf seinem Selbstoffenbahrungsohr empfangen kann.
Und dann gibt es noch die Beziehungsebene. Der Sänger baut eine Beziehung auf, indem er in Resonanz geht. Mit seinen Mitmusikern, mit dem Raum, mit dem Publikum. Diese Ebene ist für mich am schwierigsten konkret zu erfassen, aber sie scheint mir gleichzeitig die Wichtigste zu sein. Wir möchten, dass unsere Kommunikation, unser Singen ankommt. Musikmachen lebt von der Resonanz. In den musikalischen Sternstunden scheinen Musiker und Zuhörer zu verschmelzen und treten in einen Austausch. Öffnen die Zuhörer (oder auch die Mitmusiker) ihr Beziehungsohr, kann der Klang ankommen. Treten die Chormitglieder miteinander in Resonanz, kann Zusammenklang gelingen. Tritt der Solosänger wirklich in Resonanz mit dem Raum, in dem er singt, wird sich die Dynamik dem Raum angemessen entwickeln.
Singen ist mehr als Sachinhalt
Als kleines
Experiment empfehle ich, ein Lied „mit verschiedenen Ohren“ zu singen.
So wird zum Beispiel im Chor sehr schnell deutlich, auf welcher Ebene
noch Potential ungenutzt ist. Singen und Hören wir auf dem
Sachinhaltsohr, geht es vor allem um die Frage „Richtig oder Falsch?“,
„Schön oder nicht schön?“. Natürlich möchte ich als Chorleiterin, dass
mein Chor die korrekten Töne singt. Aber ich bin mir auch bewusst, dass
die Arbeit auf dieser Ebene schnell zu Stress und Frustration führen
kann, weil es häufig um eine Bewertung geht. Die neutrale Aussage, der
Tenor habe da ein fis und kein f, mag manchem helfen und in mancher
Situation richtig und wichtig sein. Sie führt aber in den wenigsten
Fällen dazu, dass eine lebendigere Musik entsteht. Wenn Menschen damit
beschäftigt sind, Dinge richtig zu machen und das zu erfüllen, was von
Ihnen erwartet wird, werden sie häufig unflexibel. Sie möchten die Dinge
unter Kontrolle bringen und können somit nicht mehr auf ihre Intuition
und stimmliche und musikalische Selbstregulationsmechanismen
zurückgreifen.
Ich will eure Hände sehn!
Singen wir ein Lied
mit Betonung auf dem Appellaspekt, klingt es ganz anders, als wenn wir
uns auf den Sachinhalt konzentrieren. Vom Frontsänger einer Tanzband
wird klar erwartet, dass er implizit oder explizit die Zuhörer
auffordert, sich zu bewegen. Doch auch im Chor ist es spannend zu sehen,
was geschieht, wenn ein Musikstück plötzlich mit der Betonung auf dem
Appellaspekt gesungen wird. Wird nicht näher erwähnt, welcher Art die
Aufforderung sein soll, gibt es in der Gruppe Missverständnisse. Der
eine möchte zum Mitklatschen auffordern, der andere lieber die volle
Aufmerksamkeit des Lauschens von den Zuhörern einfordern. Hier ist es
Aufgabe des Chorleiters, auf dieser Ebene Klarheit zu schaffen. Das
gehört genauso zum Stück, wie die richtigen Töne mit dem richtigen Text
an richtiger Stelle.
Selbstoffenbahrung hat mit Offenheit zu tun
Der
Solosänger möchte häufig vor allem das Selbstoffenbarungsohr seiner
Hörerschaft erreichen. Er möchte etwas von sich zeigen. Sich selbst
mitteilen, den emotionalen Inhalt der Musik transportieren. Gelingt es
ihm, seine eigene Lust und Freude am Tun zu zeigen, ist schonmal viel
gewonnen. Das kann, vor allem, wenn viele Menschen zusammenkommen, sehr
mitreißend sein. Ein Gospelchor, der die kraftvolle Energie der Musik
wirklich auskostet, kann dabei genauso begeistern, wie ein Jazzensemble,
dass die harmonische Komplexität der Stücke und die damit verbundenen
Spannungen klar erlebt. Schwierig wird es meiner Meinung nach immer
dann, wenn verschiedene gegensätzliche Informationen dieser Ebene sich
überlagern. Wollen und Lampenfieber, Schüchternheit und
Extrovertiertheit oder eine innere Erwartung, wie etwas zu sein hat und
der Wunsch nach Authentizität.
Egal was sich offenbahrt, für mich ist es immer am schönsten, wenn es echt und stimmig ist. Möchte ich als Sänger etwas ganz bestimmtes offenbaren, ist es meine Aufgabe, dieses Etwas wirklich in mir zu finden und auch festzustellen, was den freien Ausdruck dessen vielleicht noch behindert. Möchte ich als Chorleiter meinen Chor aus der Reserve locken, muss ich geschickt vorgehen um die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Sonst entsteht z.B. statt einer echten Begeisterung schnell eine forcierte Lautheit oder statt einer wirklich gemeinsam empfundenen Innigkeit eine zähe, leisere aber nicht besonders präsente Chorsoße.
Beziehung hält die Ebenen zusammen
In meiner
Arbeit wird vor allem die Kommunikation auf dem Beziehungsohr immer
wichtiger. Ohne Beziehung laufen der Appell und die Selbstoffenbahrung
ins Leere. Ich lasse häufig meinen Chor ganz bewusst beim Singen eines
Stückes Beziehung aufnehmen. Zu zweit Rücken an Rücken, lauschend in den
Raum, oder durch Übungen, die die Schwarmintelligenz herausfordern.
Zu
meinen Lieblingsübungen gehört es, dass der Chor im Kreis sitzt und
immer zwei Menschen sich anschauen, dann aufstehen und ihren Platz
tauschen. Immer nur ein Paar soll diese Aktion durchführen, niemals
stehen mehr als zwei Menschen gleichzeitig.
Aber auch harmonisches
Hören im Chor ist Beziehung. Anstatt einzelne Stimmen wieder und wieder
linear zu üben, kann ich schon recht früh zwei Stimmen zusammen singen
lassen, damit die Sänger lernen, sich am Zusammenklang zu orientieren.
Allein
die Aufforderung an den Chor oder die Musiker, mit denen ich als Solist
zusammenarbeite, die eigene Aufmerksamkeit auf die Beziehung zu lenken,
kann einiges Bewirken.
Im Idealfall schaffe ich es, alle vier Ohren meiner Zuhörer zu erreichen. Die Freude am Tun und an der Gemeinschaft, sowohl im Chor, als auch mit den Mitmusikern oder mit dem Publikum, kann dabei in vielen Situationen ohr- und herzöffnend sein. In diesem Moment entsteht eine Kommunikation, die keiner Worte bedarf und die jenseits aller Bewertung oder Konkurrenz ist. Letztendlich geht es um echten, aufrichtigen Kontakt. Dann macht Singen besonders froh!
Eine Woche mit offenen Ohren wünscht,
Anna Stijohann