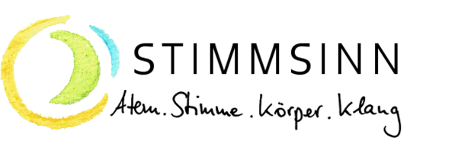Ich vermeide in meinem Unterricht wenn möglich die Begriffe „richtig“ und „falsch“.
Ist das sinnvoll? Geht das überhaupt? Gibt es ein konkretes Ergebnis, wenn ich als Gesangspädagoge mich mit Bewertungen und Urteilen so gut es geht zurückhalte?
Ich denke ja und bin sogar der Meinung, dass wirklich tiefgehende Erkenntnis und Entwicklung nur möglich sind, wenn mein Tun, mein Experimentieren nicht im Sinne eines „objektiven“ Maßstabes bewertet wird.
Lösung für alle Probleme. Jetzt!
Wenn wir Gesangsunterricht nehmen, möchten wir wissen, wie „es geht“. Wir möchten, dass der Lehrer uns ganz genau sagt, was wir richtig und gut machen und was wir noch verbessern müssen. Wir möchten am liebsten auf Knopfdruck die Lösung für alle unsere Probleme und die Antwort auf alle Fragen. Wir möchten am Ende „Singen können“. Dieses Leistungsprinzip haben wir alle durch unsere Schulausbildung und über die Grundsätze, nach denen unsere Gesellschaft zu funktionieren scheint, tief verinnerlicht. Schade eigentlich. Wir nehmen uns damit in vielen Fällen die Chance, über uns selbst hinauszuwachsen und etwas zu lernen, was sich nachhaltig einprägt und uns wirklich eigen ist.
Niemand kann einem Singen beibringen
Singen ist eine sehr persönliche und zudem komplexe Angelegenheit (vgl. Singen ist nicht kompliziert!). Es gibt keine objektiven Maßstäbe, keine ultimativen Methoden und nicht das eine Patentrezept, dass jeden von uns plötzlich frei singen lässt. Wir sind immer auf dem Weg und niemals vollständig angekommen. Ich als Lehrer begleite einen Schüler auf diesem Weg, weise auf Fortschritte oder Kreuzungen hin und mache auf die Dinge aufmerksam, die ich aufgrund meiner Erfahrung klarer sehe als der Schüler.
Trotzdem ist jeder Lehrende auch noch Lernender. Niemand weiß alles und vor allem kann kein Lehrer dieser Welt seinem Schüler „beibringen“ zu singen. Singen lernen ist wie Fahrrad- oder Skifahren. Wir müssen es durch Ausprobieren, Üben und durch eine aufmerksame Begleitung, die hilft, wenn wir ins Schleudern geraten, trotz allem aus uns selbst heraus lernen.
Mein kleiner Sohn kann seit ein paar Monaten Fahrrad fahren. Niemals würde ich auf die Idee kommen ihm zuzurufen: „Nein, die Kurve hast Du falsch genommen. Du musst mehr Gewicht auf Deine linke Pedale geben. Das war nicht richtig. Beim richtigen Fahrradfahren muss man den Kopf auf genau diese Weise halten. Mach das noch mal und streng Dich mehr an.“
Singen ist nicht schwarz-weiß
Bewertungen suggerieren uns, es gäbe die eine „ultimative Wahrheit“, einen objektiven Maßstab, wie Singen zu sein habe. Natürlich gibt es Merkmale, an denen ich erkennen kann, ob eine Stimme frei schwingt, ob sie gut mit dem Körper verbunden ist, ob ein Ton tragfähig ist, ob ein Klang im Rahmen einer Stilistik verwendbar ist. Aber wie im richtigen Leben lassen sich die allerwenigsten Situationen in schwarz und weiß beschreiben. Die Zwischentöne und Nuancen sind das Wichtige. Nur so bleiben wir beweglich und entwicklungsfähig.
Wir können den Klang einer Stimme oder eines Tons sehr wohl beschreiben ohne ihn zu bewerten. Das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die ich versuche auch meinen Schülern mit auf den Weg zu geben. Ebenso möchte ich auch meine eigenen Empfindungen beim Singen wahrnehmen lernen, ohne sie zu werten. Natürlich darf ich mich freuen, wenn das Singen plötzlich viel leichter ist als noch zuvor, und mich fragen, warum das nicht immer so ist. Ich möchte aber auch in meiner Sprache immer darauf achten, dass ich nicht durch vorschnelle Abwertungen und scharfe Selbstkritik eine „Tür zu schlage“.
Unschärfe hilft das Ganze zu sehen
Betrachten wir einen Ameisenhaufen von weiter weg, denken wir vielleicht, es sei nur ein Erdhügel. Kommen wir aber näher heran, sehen wir, wie es wuselt und lebt. Gehen wir noch näher heran, sehen wir die einzelne Ameise, verlieren aber damit auch den Blick auf das ganze zusammenhängene Gefüge. Je genauer und detallierter wir auch beim Singen unsere Worte wählen, desto mehr verlieren wir das große Ganze aus dem Blick. Denn das Ganze ist stets mehr als die Summe seiner Teile. Deswegen lasse ich sehr oft die Schüler mit eigenen Worten beschreiben, was sie erleben. Ebenfalls sehr oft bekomme ich als Antwort zu hören: „Aber ich kann das ja nicht so genau sagen, ich kenn mich da nicht so aus, wie das wirklich ist…“
Dabei sind die eigenen Empfindungen – in eigenen Worten ausgedrückt – häufig mehr wert als jede „anatomische Korrektheit“. Rein physiologisches Wissen muss sich mit Erlebtem verbinden, sonst bleibt es inhaltsleer. Manchmal erläutere und ergänze ich das, was der Schüler selber wahrnehmen konnte: „Ja, das kann man so ausdrücken. Hier und da geschieht rein muskulär dann das und das. Vielleicht hilft dir das ja, Deine eigene Wahrnehmung nochmal genauer zu greifen. Mach das doch noch einmal und spür genau hin.“ So kann seine Aufmerksamkeit vielleicht auf etwas gelenkt werden, was vorher noch nicht in seinem Bewusstsein war.
Zwei verschiedene Autobahnen
Sich „unscharf“ oder „unwissenschaftlich“ auszudrücken, hat in diesem Fall also rein gar nichts mit inhaltsleerem Geschwafel zu tun. Nein, ich entscheide mich häufig ganz bewusst dafür. Es kommt mir vor, als wären die zwei verschiedenen Arten sich auszudrücken – klar, nüchtern, wissenschaftlich, bewertend, vermeintlich objektiv auf der einen Seite – umschreibend, ermutigend, erlebend, subjektiv auf der anderen Seite – zwei völlig verschiedene Straßen auf denen ich mich bewegen kann. Jede hat ihren Nutzen und ihr Ziel, aber manche Ziele erreiche ich eben nur über die „offene“ Spur.
Zwischentöne und zutiefst menschliches und damit auch persönliches, authentisches und berührendes Singen, ist über die „kritische“ Spur nur schwer zu erreichen. Wenn überhaupt. Außerdem nährt bewertendes Verhalten vor allem unsere Selbstzweifel. Wir möchten gut sein und die von uns geforderten Erwartungen erfüllen. Gelingt das nicht direkt, reagieren die allermeisten von uns mit Frust und das Lernen wird zusätzlich erschwert. Die Glaubenssätze, die sich z.B. in unserer Kindheit in uns abgesetzt haben – „Sei nicht so laut“, „Du singst schief“, „In unserer Familie sind eben alle unmusikalisch“ – werden so immer wieder angefeuert und lebendig gehalten. (vgl. Inner Game of Music)
Aufgaben ohne „richtiges“ Ergebnis und eine umschreibende Sprache lassen uns die „Spur“ ganz bewusst wechseln. Neugier, Offenheit und Lernbereitschaft sind die Folge.
Wörter können trennen oder verbinden
Fachbegriffe sind wichtig. Ohne Frage. Dennoch halte ich es nicht immer für sinnvoll, diese Fachbegriffe im Unterricht zu verwenden. Ich vermeide z.B. wann immer möglich die Begriffe „Brust-“ und „Kopfstimme“. Ich spreche von „Mischung“ und erläutere möglicherweise die funktionalen Zusammenhänge anhand eines Modells mit Gummibändern o.ä. Wie sollen wir eine Vielfalt an Klangfarben entwickeln, wenn wir in unseren Köpfen ein „entweder – oder“ – Modell haben? Trennen wir Dinge mit Worten, so erscheinen sie uns auch in der Praxis getrennt.
So gut wie nie spreche ich davon einen „Ton zu produzieren“ oder einen bestimmten „Klang herzustellen“. Ich als Sänger bin das Instrument und somit mittendrin. Ich bin der Klangkörper und meine Stimme ist persönlich. Ich kann mich nicht von meiner Stimme trennen. Durch die Art meiner Sprache kann ich Verbindung oder Distanz schaffen. Möchte ich, dass mein Singen persönlich klingt und ich mich im Klang wiederfinde, brauche ich die Nähe.
Pfui Stütze!
Ein weiterer Begriff ist die „Stütze“. Es gibt so viele Konzepte davon, wie der Körper die Stimme beim Singen unterstützen kann, wie es Gesangslehrer gibt. Und ich bin mir sicher, jeder muss selber herausfinden, wovon seine eigene Stimme am meisten profitiert. Der eine denkt ganzkörperlicher (z.B. Faszienarbeit), ein anderer empfindet ganz bestimmte Resonanzraumausnutzung als wichtige Unterstützung. Jemand drittes erlebt Bewegung als Schlüssel zum vollen, ausbalancierten Ton, noch jemand anderem hilft eine „Zug-Gegenzug“-Erfahrung z.B übers Saugen. Auch die Bauchpresse alter Schule geistert immer noch durch Chöre und unter Kollegen.
Spreche ich von „der Stütze“ suggeriere ich dem Schüler, es gäbe die eine ganz konkrete Problemlösung, die man entweder drauf hat oder eben nicht.
Ebenso spreche ich ungern von „Kontrolle“, sondern eher von „Kontakt“, „Mitgehen mit dem Schwung“ oder suche gemeinsam mit dem Schüler nach dem Moment, wo einfach „alles zusammenpasst“. Begreifen über den Körper oder auch über Imagination kann genauso konkret und abrufbar, ja sogar tiefgehender sein, als kognitives Verstehen und Etikettierung mit Fachbergriffen.
Profi sein oder Wissen ist Macht!
Gerade unter Kollegen fällt es mir auf, dass häufig mit schlauen Begrifflichkeiten um sich geworfen wird. Sowohl im persönlichen als auch im schriftlichen Austausch wird mir manchmal ganz schwindelig vor lauter Fachchinesich. Nicht, dass ich nicht die meisten Begrifffe auch kennen würde und um ihre Bedeutung wüsste. Es scheint mir jedoch manchmal, als wolle der Kollege oder die Kollegin vor allem seine eigene Kompetenz und sein Wissen in den Vordergrund stellen. Ich nehme mich selbst davon nicht aus und stelle es auch immer mal wieder fest, dass ich, wenn ich versuche „auf Augenhöhe“ mit einem (vielleicht vermeintlich erfahreneren) Kollegen zu sprechen, gegebenenfalls etwas dicker auftrage, weil ich Angst habe, eine allgemeinere Sprache könnte mir als Zeichen von Schwäche und Unwissen ausgelegt werden.
Auch auf das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer hat die Art der Sprache große Auswirkungen. Stelle ich mich als Lehrer als „Experte“ dar und wähle meine Worte entsprechend, schaut der Schüler vielleicht zu mir auf. Ich stelle eine klare Hierarchie her, in dem ich deutlich mache: Ich bin wissend, Du bist unwissend. Ich bin groß, Du bist klein. Ich traue meinem Schüler nicht zu, dass er selber weiß, was für ihn gut ist. Abhängigkeit spielt möglicherweise eine Rolle. (vgl. Sehnsucht nach der sängerischen Freiheit)
Wähle ich dagegen Worte, die dem Schüler nah sind, erreiche ich ihn anders und begegne ihm auf Augenhöhe. Die Lernumgebung verändert sich. Druck wird ersetzt durch Vertrauen. Beiderseitiger Respekt schafft einen Raum, in dem wirklich Entwicklung möglich ist.
Fachsprache ist manchmal nötig
Natürlich ist es nötig bestimmte Fachbegriffe zu kennen. Sie wurden erfunden um Kommunikation zu erleichtern und konkrete Sachverhalte möglichst ohne Missverständnisse in ganz konkrete Worte zu fassen. Allein um Fachliteratur zu verstehen, brauche ich ein bestimmtes Fachvokabular. Deshalb ist es mir auch ein Anliegen, fortgeschrittene Schüler und Studenten mit einigen Begriffen vertraut zu machen. Ich selbst habe viel aus Büchern gelernt und das wäre anders gar nicht möglich gewesen. Trotzdem sollten wir im Hinterkopf behalten, dass auch alle Fachbegriffe nur der Versuch sind, Dinge und Phänomene zu versprachlichen, die eigentlich viel komplexer sind als das, was unser Verstand begreifen kann. Einen Muskel benennen zu können kann in der Kommunikation helfen, weil dann klar ist, worüber geredet wird, wirklich weiterhelfen tut es aber dennoch selten.
Begriffe helfen uns, unsere Wahrnehmungen zu sortieren. Am Ende braucht aber jeder für sich sein eigenes Ordnungssystem.
Wenn es wichtig ist, dass etwas „richtig“ gemacht wird
In manchen Unterrichtssituationen ist es dennoch wichtig, dass der Schüler etwas „richtig“ macht. Z.B. eine Übung korrekt ausführt, die ansonsten nicht den gewünschten Effekt hervorbringt. Selbst in so einer Situation versuche ich, den Schüler nicht zu bewerten und seine Bemühungen als „falsch“ abzustempeln, sondern ihn auf die andere, von mir eigentlich angestrebte Möglichkeit hinzuweisen.
Scheint meint Plan aufzugehen, ermutige ich durch Kommentare wie „gut“, „ja genau“ oder „jetzt passiert was“. Dass dieses „gut“ eine subjektive, positive Bestärkung und keine objektive Bewertung ist, ergibt sich in der Regel direkt aus dem Kontext.
Merke ich z.B. dass der Schüler eine Aufgabe zuvor schon genauer erledigt hat, aber nach einiger Zeit mit der Konzentration abschweift oder ungenau wird, bemühe ich mich ihn freundlich oder auf humorvolle Art („Nä! Mach nochmal…“, „War xy noch in Deinem Bewusstsein?“ usw. ) wieder ins genaue Arbeiten zurückzuholen. Gelingt das nicht oder nur schlecht, probiere ich meistens etwas anderes aus. Meine Erfahrung ist, dass sich Dinge, die uns interessieren, am Besten manifestieren. Der Schüler muss sich für etwas begeistern, „Lunte riechen“ und eine Übung muss interessant genug sein – im Tun oder im Ergebniss – dass er sich von alleine neugierig weiter auf den Weg macht (vgl. Wieviel muss ich üben?)
Ob der Schüler dann das lernt, was ich ursprünglich vorgesehen hatte oder etwas anderes, ist mir dabei ziemlich egal!
Lust an der offenen Sprache und Freude an der Begegnung auf Augenhöhe wünscht,
Anna Stijohann