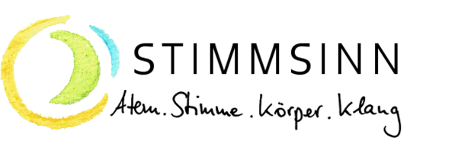Über den Tellerrand

Zu Beginn der Sommerferien habe ich mich mit vier engagierten Gesangspädagogikkollegen zum Austausch getroffen. Dieses Treffen hat in mir noch lange fortgewirkt und gerade die offenen Fragen, die unterschiedlichen Meinungen und Schwerpunkte regen mich noch immer zum Nachdenken an. Eines der Themen, die uns intensiv beschäftigt haben, ist die Frage nach der Selbstverantwortung jedes einzelnen Schülers. In einigen meiner vergangenen Artikel kam dieses Thema und meine Meinung dazu schon zur Sprache (vgl. Wieviel muss ich üben? oder Die Sehnsucht nach der sängerischen Freiheit), aber durch die Diskussion mit den Kollegen konnte ich noch neue Einsichten hinzugewinnen. Die möchte ich heute und hier mit euch teilen.
Was brauchst Du?
In der Regel beginne ich jede Einzelstunde mit der Frage an meine Schüler: „Was brauchst Du?“ Oder auch mal: „Was kann ich heute für Dich tun?“ Diese Fragen habe ich bisher immer schon als genügende Aufforderung an den Schüler verstanden, sich Gedanken zu machen was gerade anliegt. Die Fragen bieten die Gelegenheit in sich hineinzuhorchen, zu reflektieren, wo man gerade steht, was man sich von der Stunde verspricht und für mich die Chance dort anzuknüpfen, wo der Schüler aus sich selbst heraus ein Interesse hat. (vgl. Wieviel muss ich üben? oder Losgehen mit dem was ist) hat.
Die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus. Von „Was ist das für eine blöde Frage?“ von einer schlechtgelaunten Schülerin über schwammige Beschreibungen des eigenen Zustandes bis zu ganz konkreten Fragen zu einem Stück oder einer technischen Angelegenheit begegnet mir alles. Viele Schüler müssen sich erst langsam an die Eigenverantwortung gewöhnen und antworten gar mit: „Ja, ich finde, wir können einfach da weiter machen, wo wir aufgehört haben.“ oder „Dir fallen immer so tolle Sachen ein, mach Du mal!“
Und damit sitzen wir in der Falle. Die Aufforderung nach Selbstverantwortung wird an mich zurück gegeben und im schlechtesten Fall entsteht eine reine, innere Konsumhaltung, frei nach dem Motto: „Du gibst, ich nehme. Bespaß mich. Jetzt!“
Was ist das Problem? Woran können wir das üben?
Eine meiner lieben Kolleginnen ist im praktischen Einfordern der Selbstverantwortung viel konsequenter als ich. In unserer kleinen internen Fortbildung hat sie eine Schülerin von mir unterrichtet und begann die Stunde mit: „Woran willst Du arbeiten?“. Das war für meine Schülerin gar nicht so leicht zu beantworten. Nach einigem Hin und Her, merkte die Schülerin an, dass sie manchmal in Chorproben das Gefühl hat, dass sich ihr nach einer Weile des Singens der Hals zuschnürt und das Singen anstrengend wird. „Gut“, sagte meine Kollegin, „gibt es eine konkrete Situation, ein Stück oder eine bestimmte Stelle, in der das passiert? Ich möchte, dass wir gemeinsam etwas ganz Konkretes finden, an dem wir arbeiten können.“ Diese Auffordung war für meine Schülerin aber eher überfordernd, und ich konnte es mir nicht verkneifen, ein wenig vermittelnd einzugreifen und vorzuschlagen, das Stück, an dem wir zuletzt gearbeitet hatten, zu nehmen und zu schauen, ob es dort eine konkrete Stelle gibt, die sich eignet, daran zu arbeiten.
Wie weit geht die Selbstbestimmung?
Höchst spannend war das für alle Beteiligten. In der anschließenden Diskussion unter uns Pädagogen berichtete die Kollegin von ihren grundsätzlichen Erfahrungen mit dieser Einstellung. Sie erzählte auch von ihren eigenen Schwierigkeiten zu Beginn, wirklich hartnäckig zu bleiben und die Schüler quasi zur „Verantwortung zu erziehen“. Gerade in der Musikschule und mit jüngeren Schülern, die ansonsten nur selten gewohnt sind Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen, konnte sie – nach einer Weile der gegenseitigen Orientierung – sehr gute Erfahrungen machen. Schüler begannen, sich selber Stücke rauszusuchen, genau hinzuhören, was ihre Vorbilder machen und Ehrgeiz und eine ganz konkrete Vorstellung zu entwickeln, was sie lernen möchten. Eine äußerst erfreuliche Entwicklung, dem stimmten wir im Kollegenkreis zu. Dem ein oder anderen von uns kamen eigene Unterrichtssituationen in den Sinn und in allen Köpfen fingen Konzepte an sich zu bewegen und zu verschieben.
Was will ich lernen?
In mir hat diese Erfahrung noch reichlich nachgewirkt und ich habe mich gefragt, warum ich nicht ebenso konsequent bin im Einfordern der Selbstverantwortung. Bin ich einfach nicht vehement genug und auf der persönlichen Ebene zu vorsichtig? Hatte ich Angst, dass ein Schüler mich mit einem Problem konfrontiert, für das ich keine Lösung parat habe? Vielleicht.
Aber bei meinen Überlegungen bin ich auch zu zwei wichtigen Einwänden gekommen, warum ich nur sehr selten vom Schüler ein ganz konkretes Anliegen einfordere.
Zum Einen fällt es Schülern manchmal wirklich schwer, überhaupt zu spüren, was ihr Bedürfnis gerade ist. Anfänger möchten manchmal einfach nur „singen lernen“ und haben gleichzeitig überhaupt keine konkrete Vorstellung davon, wie das gehen kann. Was bedeutet es, singen zu können? Wo ist der Maßstab für das, was man lernen kann? Orientiere ich mich an äußeren Anforderungen – hoch singen können, Töne treffen, so zu klingen wie das eigenen Idol – oder nehme ich mein eigenes Gefühl als Gradmesser für meinen Lernfortschritt? Das ist mitunter sehr schwierig. Mir sind schon Menschen begegnet, die jahrelang und teilweise auch bei namhaften Kollegen Unterricht hatten und nach meiner Stunde völlig überrascht waren, dass Singen wirklich so leicht und genussvoll sein kann.
Über den Tellerrand singen
Und damit komme ich zu meinem zweiten wichtigen Einwand, der mich bestärkt, dass Selbstverantwortung beim Singenlernen wichtig ist, aber auch seine Grenzen hat. Jeder von uns – egal ob Profi, fleißiger Chorsänger oder Anfänger – hat seinen eigenen Sing- und Stimmkosmos, in dem er sich bewegt. Wir hören bestimmte Musik, mögen bestimmte Sänger und haben eine Vorstellung davon, wie Singen zu sein hat. Orientieren wir uns an unseren eigenen ganz konkreten Problemen oder Wünschen beim Singen, so bleiben wir, selbst wenn wir sehr fleißig und auch neugierig sind, fast immer innerhalb unserer eigenen Grenzen. Je konkreter das Anliegen, desto konkreter das Ergebnis. (vgl. Wie sag ich’s meinem Schüler?) Das ist manchmal wünschenswert und nötig, aber eben manchmal auch nicht.
Wäre ich nicht in manchem Workshop und mancher Unterrichtsstunde mit Dingen konfrontiert worden, die ich mir selber niemals zum Thema gewählt hätte, ja, die mir sogar manches Mal zuwider waren, so wäre ich um viele Erfahrungen und meine Stimme um viele Klangfacetten ärmer.
Ergebnisoffen arbeiten öffnet den eigenen Horizont
Gerade durch das Arbeiten ohne Ziel, ohne konkrete Problemstellung und in reichlich Vertrauen auf meine Lehrerin und die Gruppe, die mein Lernen unterstützte, konnten sich ganz neue Welten öffnen. Welten und stimmliche Dimensionen, von denen ich vorher nicht wusste, dass sie überhaupt relevant sind, manchmal nicht einmal wusste, dass sie existieren. Gerade im Arbeiten mit Anfängern liegt es in der Verantwortung des Lehrers Möglichkeiten aufzuzeigen und den Schüler zu ermutigen, einen anderen Weg und einen anderen Fokus zu suchen, als den bekannten. Aber auch mit gestandenen Profis halte ich es immer wieder für wichtig, aus dem bekannten Kosmos auszusteigen und sich ganz und gar überraschen zu lassen, wohin das eigene Singen noch gehen kann. Diese innere Offenheit ermöglicht es uns immer wieder, wirklich unser ganz eigenes Potential zu entfalten.
An dieser Stelle reibe ich mich mit der Einstellung meiner geschätzten Kollegin und ich bin zutiefst dankbar dafür. Auf diese Weise kann ich mein eigenes Handeln und meine eigenen Prinzipien nochmal anders hinterfragen und werde in Zukunft vielleicht in einigen Situationen anders handeln als zuvor.
Jede Situation, jeder Schüler ist anders
Auf jeden Fall bin ich sensibilisiert für die
unterschiedlichen Bedürfnisse und Situationen meiner Schüler. Mit einem
Studenten an der Uni, bei dem es einerseits darum geht Handwerkszeug zu
erwerben, aber andererseits auch um einen Einstieg in die Weiten des
Singens, das Finden der eigenen Neigungen und musikalischen Vorlieben
und ein Kennenlernen von Neuem, gehe ich anders um, als mit einer
Anfängerin, die zu mir kommt, weil sie „immer schon singen lernen
wollte“ und sich nun endlich mal durchgerungen hat Stunden zu nehmen.
Ich
lege sehr viel Wert darauf, dass meine Schüler lernen selbst
Verantwortung zu übernehmen. Vor allem Wachheit für die eigenen
Erfahrungen spielt da für mich eine Rolle. Aber ich habe auch großes
Verständnis, wenn jemand – gerade am Anfang – den Wald vor lauter Bäumen
nicht sieht und erlebe es auch immer wieder, dass jemand ein so starres
Selbstbild hat, dass es meiner Meinung nach nötig ist, zunächst die
eigenen Grenzen aufzubrechen.
Diese kleine dreistündige interne Fortbildung mit den Kollegen hat mich auf jeden Fall äußerst inspiriert. Das kann ich nur allen anderen ans Herz legen. Tut euch zusammen und reibt euch! Weitere Themen, die auftauchten und über die es sich sicher auch zu schreiben lohnt, waren „Was ist nötige Detailarbeit und was ist bloßes „Gefuckel“, das vom eigentlichen Singen ablenkt?“ und „Wieviel Psychologe bin ich als Gesangspädagoge bzw. möchte ich sein? Wo ziehe ich da die Grenze?“ Hochspannend und wohltuend zu merken, dass manche Fragen, egal wie unterschiedlich jeder auch arbeiten mag, jeden auf seine Weise beschäftigen.
Forschen lebt von Austausch und Reibung! Danke an alle Kollegen, die das wertschätzen können!
Schülerorientiertes Unterrichten und tellerrandübergreifende Ereignisse wünscht,
Anna Stijohann